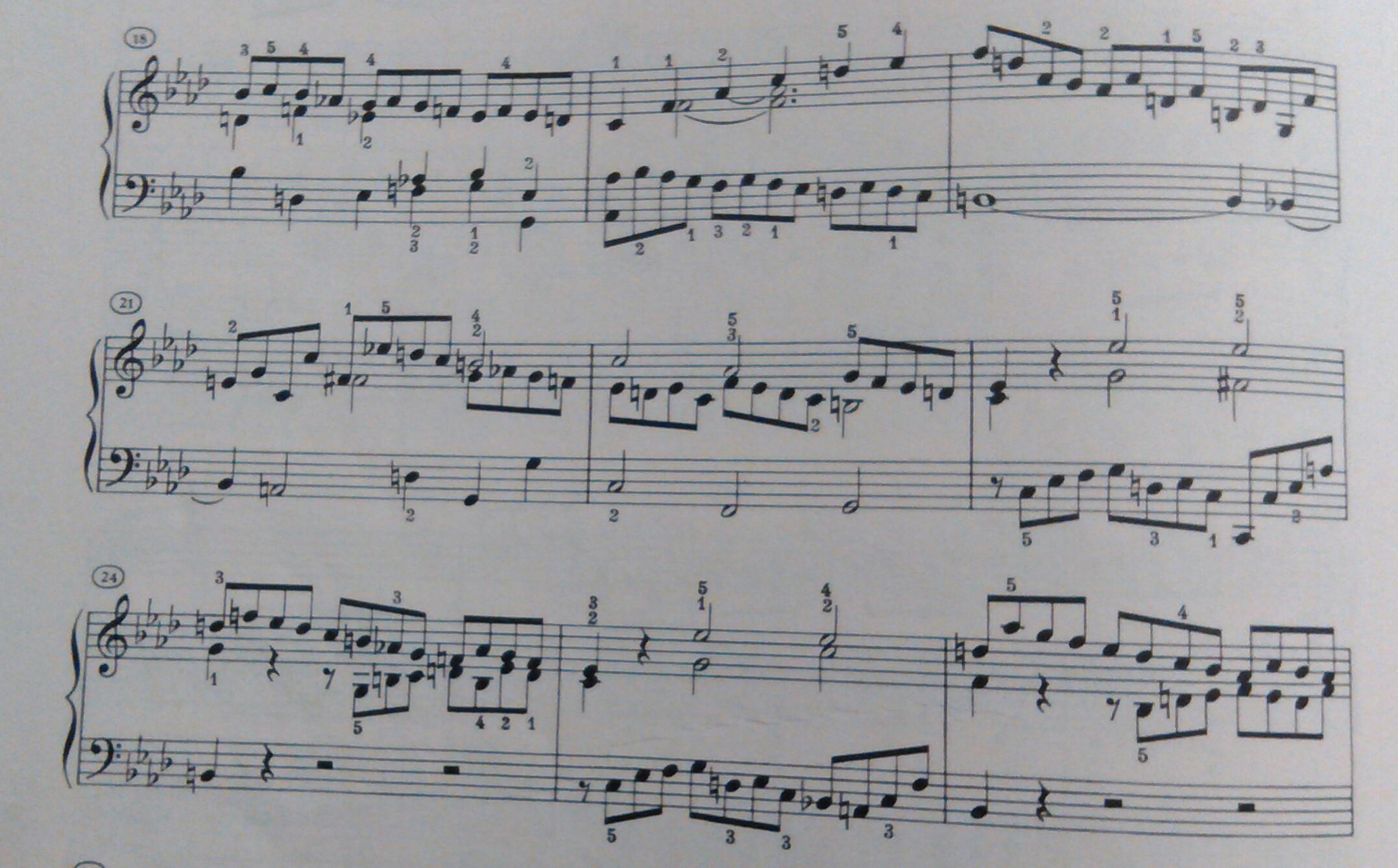Gelbwesten rumoren revolutionär – ohne Worte, dafür autoaggressiv. Frankreich, das Mutterland der Gotik, zerlegt sich selbst. Hier ein langer Text aus dem Sommer 2016, vielleicht nach wie vor lesenswert – wenn denn noch christliche Geduld vorhanden ist …
Manchmal im Leben sind wir stark. Besonders dann, wenn man es uns gar nicht zutraut. In jungen Jahren können Höchstleistungen heranreifen, ohne dass es so richtig bemerkt wird. Vorzug der Jugend ist es ja seit unvordenklichen Zeiten, Dinge auszusprechen, die später lieber ungesagt wären und dann im Nachgang autobiographisch aussortiert werden möchten. Daher wurde immer schon viel eliminiert, durch Verbrennen von Tagebüchern und Briefen, im Abstreiten mündlicher Einlassungen oder gar in autoritär veranstalteten Vernichtungsaktionen umfassender öffentlicher Art und Weise.
Eine darauf indes unvermutet dennoch folgende Trauerphase ob der persönlichen wie gesellschaftlich-historischen Verluste wurde in der guten alten Zeit gern kompensiert in familiär stilisierten Erzählungen nach dem Motto „Weißt du noch?“ – oder in wunderbar fragwürdigen, zeitweilig in Mitteleuropas architektonischem Kunstgeschmack allgemein angenommenen Formen von Neorenaissance oder Neugotik.
Das neunzehnte Jahrhundert lässt sich einfach nicht abschütteln; es ist präsent bis heute hin. Neulich war ich einmal wieder in Goslar, und die weitgehend neuromanische Kaiserpfalz hat es mir erneut ganz heftig angetan. Da störte auch das Standbild von „Wilhelm dem Großen“ in keiner Weise. Man muss das alles nur zu deuten wissen. Einen bösen „Nationalismus“ aus den Statuen und Gemälden von Staufern und Hohenzollern abzuleiten wäre ganz grober Unfug. Dass genau dies aber heutzutage oftmals geschieht, sobald „Deutschland“ ins Spiel kommt, bis in die Jugendorganisationen etablierter Parteien hinein, offenbart eine Geschichtsvergessenheit, bei der zweifelhaft wird, ob man ihr überhaupt noch irgendwie beikommen kann.
Heutige Geschichtsvergessenheit schreit zum Himmel
Da fordert also die „Grüne Jugend“ den Verzicht auf selbstbewusstes Präsentieren der schwarz-rot-goldenen deutschen Farben. Sie weiß ganz augenscheinlich nicht, dass diese Trikolore für Vormärz und 48er-Revolution steht. Ihr ist völlig ungeläufig, dass das zweite Kaiserreich diese Fahne ablehnte und das „dritte“ Reich sie gnadenlos bekämpfte. Stattdessen empfiehlt eine Sprecherin das Schwenken von grünen – ähm: Tüchern, sozusagen. Nun, sie kann ja, wenn sie das präferiert, gern nach Saudiarabien auswandern; keine Staatsflagge der Welt ist grüner als die der neureichen Wüstendiktatur, die zwischen dem Glamour marmorn-morgenländischer Geheimnistuerei und dem blutrünstig-radikal Bösen hinundherpendelt und uns, den ach so aufgeklärten, aber zugleich ölgierigen Westen seit langem schon zum Narren hält.
Um unser einundzwanzigstes Jahrhundert zu verstehen, ist ein Blick ins neunzehnte saeculum nicht unangezeigt. Wir sind ja zu Recht hilflos bestürzt, dass der sogenannte „Islamische Staat“ jahrtausendealte Kulturdenkmäler zerstört hat. Assyrische und babylonische Paläste und Plastiken, griechisch-römische Säulenstraßen, jüdische Synagogen, christliche Klöster und sogar Heiligtümer der eigenen Religion wurden im Namen eines gnadenlos grausamen Wahhabitismus dem Erdboden gleichgemacht – von den Qualen durch diese Ideologie bei den betroffenen einzelnen Menschen gar nicht erst zu reden.
Alles, was wir aus sicherer Entfernung von Kindesbeinen an über Sindbad den Seefahrer, Aladin und die Wunderlampe und Hadschi Halef Omar kennengelernt hatten, dieser ganze Zauber von Tausendundeiner Nacht oder nemsischer Reiselust erweist sich derzeit als fata morgana riesigen Ausmaßes. Der alten arabischen und osmanischen Welt, wie wir sie aus den Büchern vom neunten bis zum neunzehnten Jahrhundert kannten, wird gerade der finale Todesstoß versetzt. Damit verschwindet übrigens auch die gesamte biblische Atmosphäre, wie sie sogar noch Pate stand für ihre eigene Interpretation im kritischen zwanzigsten Jahrhundert.
Die halbe Menschheit, die bisher ihr Leben einigermaßen unbedarft aus den Schriften des Alten und Neuen Testaments oder aus dem Koran bezog, blickt heutigentags, so sie sich dem Geschehen aussetzt, in einen furchtbaren Abgrund. Sie erkennt: Zu oft wurden heilige Überlieferungen von ihren eigenen glühendsten Verteidigern missbraucht für egoistische Zwecke. Die Zerstörung des Jerusalemer Tempels, der Dreißigjährige Krieg oder die jetzige Vernichtung des Nahen Ostens sind ihre traurigen herzzerreißenden Ergebnisse. Zeloten, alte Schweden und neue Islamisten sind anzuklagende Beispiele dafür, wie aus falschem unerbittlichem Schriftverständnis heraus am Ende dann die jeweils benutzte Religion im Ganzen zum Objekt aufklärerischer Verdammnis wurde.
Als ob das Leben wirklich schöner wäre, wenn es so gänzlich keinen Gottesglauben mehr gäbe. Die einfachen und frommen Bewohner der Vendée haben bis heute in den Geschichtsbüchern keine sonderlich vernehmbare Stimme; und die Menschen in den Weiten Russlands erst recht nicht. Wo immer aber die Revolutionsarmeen eindrangen, war das Maß an Verblendung und Mordlust nicht weniger ausgeprägt als bei all den Kreuzrittern oder Dschihadisten alter und neuer Zeit.
Bekanntlich ist die Aufklärung selber spätestens in dem Moment ad absurdum geführt worden, als Robespierre den „Kult des Wesens der höchsten Vernunft“ anordnete und alle anderen Glaubensweisen blutig verfolgte. Der Turmspitze des Straßburger Münsters wurde eine riesige Jakobinermütze übergestülpt – Urbild moderner Propaganda? Jedenfalls werden seitdem immer wieder politische Einrichtungen erhoben und verabsolutiert, etwa nach dem Motto: „Die Partei hat immer recht“ – oder dem massenhaften Schlachtruf: „Vive la République“ (der ja weniger eine demokratische Verfassung lobt denn eher ein System, dessen Träger und Repräsentanten in Eliteschulen herangezogen sind).
Und natürlich haben alle schlauen wie mächtigen Egomanen seit jenen aufbegehrenden Zeiten von den beiden damals frisch erfundenen Errungenschaften Guillotine und Marseillaise in irgendeiner Weise „gelernt“, ob sie sich nun glaubensfeindlich oder superfromm gaben: Napoleon, Hitler, Stalin, Mao, Kim Il Sung (nebst Dynastie), Ceausescu, Khomeini, Gaddhafi … Notabene: Mit des Letztgenannten „Grünem Buch“ könnten die Bewegten aus der Ecke der aktuellen junggrünen Spielverderber ja auch noch wedeln – ein Vorschlag zur Güte und für systemgerechten ideologischen Ausgleich.
Nach allem Furor kam – das neunzehnte Jahrhundert
Nach allem französischen Furor kam aber dann: das neunzehnte Jahrhundert! Mental – nicht kalendarisch – gefasst, begann es mit dem Wiener Kongress 1814/15 und endete mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs 1914. Kaum eine Epoche ist bis heute derart verächtlich gemacht worden wie dieses Zeitalter. Für so ziemlich alles, was im zwanzigsten Jahrhundert aus dem Ruder gelaufen ist, hat man dessen Vorgänger die Schuld gegeben. Wie praktisch, weil für die Nachgeborenen der seinerzeit neu entstandenen industrialisierten Welt so entlastend!
Wir lasen Hauptmanns „Weber“, ohne wahrzunehmen, dass das eben kein Heine-gezeugtes klassenkämpferisches Theaterstück sein wollte. Wir mokierten uns über die historistischen übereifrig hingebauten Häuser, ohne darin eine captatio benevolentiae oder gar einen Anflug von sehnsüchtiger Erinnerung an „schöne, glänzende Zeiten“ zu sehen. Wir ignorierten im nachhinein die schöpferische Phantasie und den ungestümen Wagemut der jenes Jahrhundert vorbereitenden Frühromantiker – obwohl wir ähnlich fühlten, ohne dies uns einzugestehen. Wir beriefen uns hierbei skeptisch-altkug auf Goethe, der ja bereits im voraus den Jungs namens Hardenberg oder Tieck oder Wackenroder alle literarische Kompetenz abgesprochen und sogar die Veröffentlichung eines Textes wie „Die Christenheit oder Europa“ von Novalis tatkräftig verhindert hatte.
Woher diese Verachtung? Vielleicht ist unserem deutschen kriegsversehrten Bewusstsein jegliches Denken in großen Linien allzu gründlich abhanden gekommen. Die Nachkriegswelt musste ja mit den nicht wieder zu heilenden Wunden des Dritten Reichs, mit unentschuldbaren Brüchen, die weder äußerlich noch innerlich abzuleugnen waren, doch irgendwie weiterleben. Wie um in der daraus resultierenden bodenlosen Aggression gegen sich selbst die eigene verpfuschte dunkle Geschichte noch zu zementieren, wähnte man, dass sogar Erhaltengebliebenes ein Ende haben müsse, und riss in Westdeutschland nach dem Zweiten Weltkrieg noch mehr Häuser ab, als überhaupt durch die schrecklichen Fliegerbomben untergegangen waren. Das betraf vor allem Bauten aus der Gründerzeit und dem Wilhelminischen Zeitalter.
Dem amerikanisierten Ideal von „Fortschritt“ opferte die Wirtschaftswundergesellschaft eine bis dahin gesamteuropäisch konsensfähige urbane Struktur und Kultur – und das Wort der Mitscherlichs von der „Unwirtlichkeit unserer Städte“ verhallte 1965 zunächst völlig ungehört. Erst zehn Jahre später, im Internationalen Jahr des Denkmalschutzes, nachdem die weltläufige Kleinteiligkeit bürgerlicher Lebensformen einschließlich schmiedeeisernen Jugendstiltoren oder säulengestützten schwarzen Klavieren längst unwiederbringlich in den Orkus der „autogerechten Stadt“ und der „Bildungsreformen“ gejagt worden war, setzte das große Jammern ein.
Im Unterschied etwa zu den anno 1797 anonym erschienenen „Herzensergießungen eines kunstliebenden Klosterbruders“ oder zu Goethes Gedanken über das Straßburger Münster (bereits 1772) waren die Konzepte nachdenklich und wehmütig gewordener westdeutscher Bürger indes unfähig, sich positive Leitbilder aus der versunkenen Geschichte heranzubilden. Wie auch, wo gerade das im Krieg unzerstörte Villenviertel einer Stadtautobahn oder der vom Bombenhagel verschonte alte Baumbestand des beliebten Kaffeegartens einer U-Bahn-Baustelle hatte weichen müssen? Die Wunden waren zu frisch geschlagen. Und die verantwortlichen Bauräte befanden sich noch lange in Amt und Würden.
Alt ist per se weder schlecht noch tot
Besser ist die Maxime: Lasst die Lebenden leben, aber die Toten nicht im Tode bleiben. Wer jetzt in der Pflicht steht, soll tun, was er nicht lassen kann und darf. Aber wer gestorben ist, kann sich auf Veränderung seines Zustands freuen. Und das heißt, gewendet auf unser Thema: Eine Gesellschaft mitsamt ihrem baulich-künstlerischen Ausdruck ist nicht einfach deshalb obsolet, weil sie etwa alt und somit vermeintlich bedeutungslos wäre. Nicht alles Soignierte ist sofort senil. Wer schon einmal in Siena war, weiß, wie zukunftsträchtig die Pflege des Alten sein kann. Liebevoll gehegte Tradition besitzt eigenen Wert, und da hätte man bei uns in Deutschland viel mehr von den italienischen Städten lernen und beherzigen können, als man es tat, da noch Zeit zum Bewahren gewesen wäre.
Sehen wir auf die Baugeschichte nördlich der Alpen, dann kommt mir ein Lexikonartikel von vor über hundert Jahren in den Sinn. Unter dem Stichwort „Gotischer Stil“ wird da nicht auf Abbruchkanten genäht, sondern ein heutzutage weithin für unmöglich gehaltener großer Zusammenhang aufgezeigt. Aus dem romanischen Stil wird durch Überspitzung der Bögen, erstmals in Nordfrankreich, die gebaute Sehnsucht nach dem himmlischen Jerusalem manifester denn je.

Diese Kunst verbreitet sich über Mitteleuropa und auf die britischen Inseln und bleibt über fünfhundert Jahre der vorherrschende Stil, bis in „nachgotische“ Ausläufer des siebzehnten Jahrhunderts hinein. Im achtzehnten Jahrhundert taucht sie wieder auf in englischen Herrenhäusern und wird wenige Jahrzehnte später zum typischen Stil auch auf dem europäischen Festland für Kirchen, Burgen, öffentliche repräsentative Gebäude, Fabriken und Wohnhäuser –
– und sie lebt, so füge ich nun hinzu, zumindest virtuell weiter in den Welten etwa von Gotham City … Die erdachte Heimatstadt von Batman ist trotz aller goddam-Düsternis cineastisch-architektonisch alles andere als reizlos. Im Zusammenwirken mit der Musik zum Film entsteht ein Kosmos jenseits wie diesseits von Gut und Böse, alles umfassend quasi von göttlich-gerechten Gewölbeschlüssen bis hin zu grauenvoll-gemeingefährlichen Gewalttaten. Maurerische Freiheitsrituale, misanthropische Fehlleistungen und mafiöse Fememorde ergeben in solch mittelalterlicher Finsternis einen furchtbaren Mix, ohne jeden Verdacht, menschenfern zu sein.
Die Gotik scheint hier ein in hohem Maße weltlich Ding zu sein, und solange Stockbrot und Schnabelschuhe, Jongleurskunst und Jokerlachen, Ritterrüstung und Ratsherrenpils veranstaltungstauglich und kassefördernd sind ob ihrer Popularität, – wird auch die dahinterstehende spitzbögig-spitzbübische Philosophie in, mit und unter uns leben, weben und sein. Die grellgeschminkten schwarzgewandeten traurigblickenden Gothic-Jünger vermischen unbedarft ihre hochaufragenden kathedralartigen Frisuren mit germanischem Brauchtum, die Errungenschaften von Flowerpower und Punk mit Haarfestiger und Druidenfuß, und sie würden nicht lachen, sondern ernsthaft zustimmen, stellte man an den Grenzen ihres geistigen Biotops das Schild auf: „Man spricht Gotisch“.
Aber wird da auch Fraktur geredet? Oder ist das alles bloß als „klosterbrudisierend“ abzutun, wie Goethe es einst tat mit den Aufsätzen von Wackenroder und Tieck? – Den Frühromantikern ging es um die Kunst an sich in ihrer leibseelischen Ganzheit. Italienbegeisterung und Nürnbergbewunderung gingen bei ihnen Hand in Hand, vorläufig noch ohne Festlegung auf einen bestimmten Stil. Dies änderte sich erst allmählich, und das hat auch ein bisschen mit der Westberliner Kiezkultur zu tun, die ihre Wirkungsstätten auf einer Briefmarke der Deutschen Bundespost aus dem Jahr 1975 wiederentdecken konnte – da waren Kreuzberger Mietskasernen abgebildet zur Feier des Internationalen Denkmalschutzes. Das gusseiserne „Kreuz“ auf dem „Berg“ indes wurde namensgebend vom Berliner Architekten Friedrich Schinkel Anfang des neunzehnten Jahrhunderts als Memorial in neugotischen Formen errichtet.
Ob Michelangelo und Raffael einerseits und Albrecht Dürer andererseits den Besuchern der Oranienstraße jemals ein Bewusstsein für den Ort, da sie lebten, demonstrierten und zerstörten, vermittelt haben, sei dahingestellt. Schinkel war von beidem inspiriert, der klassischen Italianità und der altfränkischen Zunftkultur. Neue Wache und Friedrichswerdersche Kirche haben das aufstrebende Berlin gleichermaßen vorangebracht.
Den Schub in eine bestimmte Stilrichtung gab sicherlich die Wiederauffindung der originalen Baupläne zum Kölner Dom in den Jahren zwischen 1814 und 1816. Da wurde der von Berlin aus regierte preußische Staat in seiner frisch erworbenen Rheinprovinz historisch aktiv. Als die Kathedrale schließlich im Jahr 1880 fertig war, saß der Bischof in niederländischer Verbannung. Noch herrschte Kulturkampf, ultramontanistisch befeuert und wenig romantisch. „Nationale Größe“ wurde durchaus antiklerikal zelebriert, damals wie heute. Das dürfte extreme „Rechte“ wie „Linke“ gleichermaßen erfreuen.
Robert Schumann hat in der seit dem Reformationszeitalter brachliegenden Bauruine mit dem charakteristischen Kran auf dem Stumpf des Südturms im November 1850 eine Kardinalserhebung miterlebt und seine Eindrücke im als Feierlich bezeichneten vierten Satz seiner Dritten Symphonie verarbeitet: in festlich-düsterem Bläsersatz, in der ebenso satten wie seltenen klingenden Tonart es-moll. Gotische Polyphonie?
Nein. Die Musik lud sich zwar auf mit Vorbildern der Vergangenheit, ohne jedoch ausdrücklich nazarenisch zu werden (wie es teilweise in der Malerei geschah). Wagners bösartiger Spott über „Händelssohn-Bachtoldy“ richtete sich „nur“ gegen eine seiner Meinung nach billige Kopie barocker Formen und Harmonien – ins gotische Mittelalter stieß die musikalische Romantik damals gar nicht vor. Selbst die ein halbes Jahrhundert später (1895) entstandene „Suite gothique“ des Elsässers Léon Boëllmann ist für die zeitgenössische französische Konzertorgel gedacht und hat mit der Gotik genauso viel zu tun wie etwa Bachs „Dorische Toccata“ mit der gleichnamigen Kirchentonart geschweige denn Beschaffenheit antiker Säulenkapitelle.
Mit anderen Worten: Die Künste sollten, bei aller Bewunderung der „Alten“, doch schöpferisch und phantasievoll bleiben. Nicht auf detailversessene sklavische Nachahmung waren die echten Romantiker aus, sondern auf kreative Weiterentwicklung und freien Einsatz der mannigfaltigen Tradition. Allerdings erstarrten die geistreichen feuerflüssigen Lavamassen vom Beginn des Jahrhunderts dann doch weitgehend zu abgekühlten festen Gesteinen. Das „Eisenacher Regulativ“ aus dem Jahr 1861 ist so ein zementierender Ausfluss. Man legte fest, jede neu erbaute evangelische Kirche habe sich an einem historischen Stil zu orientieren, vorzugsweise am gotischen. Bewusst schlossen sich die Verfasser dabei dem altchristlichen Schema der Basilika an – und wollten so den Protestantismus in die große Überlieferungseinheit von Antike, Mittelalter und Neuzeit hineinstellen.

Einerseits normiert, andererseits weiterentwickelt, in übertrieben zinnenbewehrten Rathausneubauten etwa, die gotischer daherkamen als ihre Vorgänger; oder in überdimensionierten Fabrikhallen, Bahnhöfen und Schulen, die kathedralähnlich anmuteten und dies auch sollten …: Sakrales und Säkulares wurde noch einmal versuchsweise zusammengebracht unter dem Schirm einer einheitlichen europäischen Kunst, deren Idee – man beachte es immer wieder – durch Architektur künstlicher Ruinen, hallender Internatskreuzgänge, großer Parlamentshäuser und industrieller Nutzgebäude aus England (!) zu uns über den Kanal herübergeschwappt war. Kreuzrippengewölbe allerorten, insular, mitteleuropäisch und nordamerikanisch so sehr en vogue, dass dieser Baustil tatsächlich zum Synonym für das neunzehnte Jahrhundert werden konnte.
Die Gotik hört einfach nicht auf …
Das zwanzigste saeculum weiß sich diesem unterschwelligen Traditionsstrom verbundener als es dies selbst in seinen klügsten Stimmen bisher je zugegeben hat. Pars pro toto sei an den aus Bremen stammenden Künstler Heinrich Vogeler (1872-1942) erinnert, dem die Gotik in dem Maße bedeutend wurde, je mehr sie faktisch in ihrer neugotischen und zugegeben allzu fialenverliebter Spielart dem Spott der Gebildeten unter ihren Verächtern ausgesetzt war. Der Kaufmannssohn hatte um die Jahrhundertwende sich ein Paradies auf Erden erschaffen im Worpsweder Barkenhoff – da passte einfach alles zusammen, von der Kommode im umgebauten und repräsentativ erweiterten Bauernhaus über das impressionistische Ölgemälde im Esszimmer bis hin zum Baumbestand und zur Blumenvielfalt umzu … Jugendstil war das Zauberfaktum, ornamental und eben alles andere als gotisch-zackig!

Diese Traumwelt von Selbstverwirklichung – noch ehe es solchen Begriff gab – befriedigte und befriedete aber nur vorübergehend. Vogeler war so sehr christlich geprägt, dass er nicht nur dem Kaiser ein pazifistisches „Märchen vom lieben Gott“ zueignete, sondern auch ganz praktisch die Folgen des Krieges auf seinem eigenen Gut bearbeiten und lindern wollte. Aus dem Barkenhoff wurde eine kommunistische Lebensgemeinschaft; die bis dahin gehegten und gepflegten bürgerlichen Schätze wurden verhökert oder „sozialisiert“. Den vornehmen Park des Anwesens grub man zu Ackerland um, der vormalige Herrensitz mutierte zu regionaler Kommandozentrale und reformorientiertem Kinderheim … Die zartgetupfte blaugeblümte Aura individualistischer Luftschlösser wich nun einem handfesten und alsbald bedenklich sowjetrussisch-propagandistisch aufgeladenen politischen Aktionismus.
Mit seiner endgültigen Übersiedelung nach Moskau Anfang der dreißiger Jahre stellte Vogeler sich ganz in den Dienst der revolutionären Regierung. Seine sogenannten „Komplexbilder“ sollten dem Wollen und Vollbringen einer neuen Zeit aufhelfen, es waren also bessere Werbeplakate. Etwas Eschatologisches oder auch Hochfahrendes oder eben Himmlischjerusalemgotisches haftet ihnen an: Da türmen sich verschiedenste ländliche wie städtische Volksszenen, Gebäudegruppen und Industrieanlagen übereinander, da gehen Arbeiter und Redner mit ihren Maschinen und Podien ineinander über, motivisch zusammengehalten durch Symbole wie den Roten Stern, den Hammer oder die Sichel.
Das Merkwürdige bei all diesen Häutungen vom reichen Bonvivant der Jahrhundertwende über den Schöpfer eines irdenen Paradiesgartens in Worpswede und Agitator der „Roten Hilfe Deutschland“ bis hin zum ausgebeuteten Erdarbeiter irgendwo in der kasachischen Steppe, wo er völlig verarmt und krank in einem Lazarett umkam: Heinrich Vogeler blieb stets ein kritischer Bewunderer der Gotik!
In seinen autobiographischen Blättern, die man später gesammelt als Buch unter dem von ihm selbst angeregten Titel „Werden“ herausbrachte, notiert Vogeler seine Erinnerung an eine Reise von Bremen nach München, die ihn als Mittzwanziger gemeinsam mit dem angehenden Dichter Rudolf Alexander Schröder (1878-1962) über Köln und Straßburg führte: „Der Kölner Dom machte in seiner geordneten Massigkeit wohl einen starken Eindruck auf mich, aber doch hatte ich mir die Gotik anders, lebendiger vorgestellt, vielleicht volkstümlicher, nicht so kalt, so formal. Jedenfalls wurde der Eindruck ganz verdrängt durch das, was ich in Straßburg sah.“ Denn: „Ich fand viel mehr bestätigt von der Gotik, als ich mir bisher durch mein Studium vorgestellt hatte. Ich war tief erregt, vor allem auch von den Skulpturen am Münster.“
Gut vier Jahrzehnte nach dieser so überaus prägenden spätadoleszenten Erfahrung schreibt der nunmehr 64jährige Künstler für die unter anderem in deutscher Sprache erscheinende Moskauer Zeitschrift „Internationale Literatur“ in seinem Aufsatz „Die Gotik“ folgendes: „Das Klassenbewußtsein der bürgerlichen Handwerker gegenüber dem Rittertum und der hohen Geistlichkeit erwacht. Die Einheit der wirtschaftlichen Verhältnisse, die befestigte Form der Staatsgewalt durch die Zünfte im Rat der Stadt gebar ein Selbstbewußtsein, ruhend auf der kollektiven Verantwortung. Dies neue Verhältnis der Menschen zum Staat, zur Kirche und zur Natur trieb zu einem eigenen künstlerischen Ausdruck, der seine vollendete Form in der Gotik fand.“
Dieser Baustil verkörpert somit ein neues Menschenbild, eine Idealgesellschaft aus urchristlichen Wurzeln und kommunistischer Sehnsucht. Vogeler bleibt sich bis zu seinem Lebensende darin eigenartig und verstörend treu, dass er von ganzem Herzen überzeugt ist, im sowjetischen Marxismus gelange die christliche Botschaft der Nächstenliebe unmittelbar zur wirklichen geschichtlichen Kraft und Macht. Schon dem jugendstilisierenden Herrn vom Barkenhoff hatte Thomas Mann sinngemäß attestiert, er, Vogeler, verfolge seine romantischen Gedanken mit einer nachgerade religiösen Intensität, so dass man ihm die persönliche Ehrlichkeit abnehmen müsse, auch wenn man selber anderen Glaubens sei. – Dieser einerseits durchgebildete milde, andererseits erschreckend naive Eifer setzt sich nach 1918 in anderen Formen bei ihm fort.
Über den gotischen Dom schreibt nun Vogeler 1936 in Moskau: „Vom Boden aus hatte jeder Stein seine tragende Bedingtheit zum Ganzen, seine Massengebundenheit. Vom Erdboden drängen sich die Steinmassen heran, ordnen und spannen ihre Kräfte, von allen Seiten aufsteigend, der eigenen Bedachung zu, dem Bodengewölbe, wo sie der Schlußstein in der Scheitelhöhe auffängt und einheitlich faßt.“ – Alle bauen am großen Ganzen mit, nichts ist nebensächlich oder gar unbedeutend: Der Dom der Vergangenheit als Anknüpfung zum Menschheitsdom, dessen Kristallisationspunkt das Dritte Rom wird?
Ja und nein. Vogeler, der deutsche Exulant zur Zeit der Stalinschen „Säuberungen“, muss vorsichtig sein. Zumindest doppeldeutig schreibt er weiter: „Auch die Innenarchitektur der Kirche änderte sich; der gehobene Chor mit der unterbauten Krypta verschwand, diese Bauart aus romanischer Zeit. Sie war charakteristisch für die Zeit der Priesterherrschaft, war Ausdruck der autoritären Isolierung der Herrschenden, deren Gebeine in der Krypta ein besonderer Platz der Verehrung eingeräumt war. Die Gotik änderte das. Jetzt sollte der Priester in gleicher Ebene mit der Bevölkerung der Städte stehen.“
Außerdem wurden „die mächtigen Mauern“ „aufgelöst durch die hohe Spitzbogenkonstruktion: farbiges Licht gemalter Glasfenster flutete in den Raum und verdrängte das mystische Dämmerlicht romanischer Weltabgeschiedenheit.“ – Gesteigerte Aktivität zugunsten einer hellen humanistisch gedachten Neuen Welt entgrenzt und verwindet den weltfremden Ästhetizismus der Sommerabende im individualistischen Barkenhoff? Hier arbeitet sich einer, der sich vielfach gescheitert sah, an der eigenen Lebensgeschichte produktiv ab – zumindest im Sinne der neuen Ideologie, die ihn so überströmend und begierig-treuherzig erfüllt.
Ein weiterer Gedanke Vogelers aus seinem Gotikaufsatz von 1936: „Die schweren Pfeiler und Säulen verwandelten sich als Säulenbündel in garbenförmige Kraftleiter. Jede Formgestaltung war der gemeinsam aufsteigenden, tragenden Idee unterstellt, gleichem Sinn dienstbar gemacht, ob es nun Werke der Steinhauerei, der Holzschnitzkunst, der Glasmalerei, der Goldschmiedekunst oder der Teppichwirkerei waren. Figürliche Bildnisse entstanden lediglich im zwingenden Rahmen der Architektur. In der gotischen Stadt war kein Raum für eine sich von gesellschaftlichen Leben und von Arbeitsdienst isolierende Person. Es war auch kein Platz für Personenkult, und deshalb gab es in der gotischen Stadt keine freistehende individuelle Denkmalkunst.“
Gemeinsam nach oben und vorwärts! Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Aber es möge sich auch niemand steinern (stählern) hervortun wollen und besondere Verdienste für sich beanspruchen! Es fällt genau jenes Wort vom „Personenkult“, das später zum Leitbegriff für die Beschreibung der Stalinschen Untaten wurde und bei Vogeler bereits 1936 als gewissermaßen „ungotisch“ benannt und beurteilt wird. Dass auch die reine Gotik gefährdet war, zeigt der Autor dann unter anderem am Beispiel jener Kathedrale, die ja schon den jungen Bremer Kaufmannssohn eingeschüchtert hatte: „Der Kölner Dom, dieser Bauriese, ist Ausdruck des intellektuellen Erfassens, ist die Dogmatisierung des gotischen Bauprinzips. Die Papstkirche verstand es auch hier, den Geist der Zeit auszunützen und die schöpferischen Kräfte für ihre Zwecke umzubiegen. Man baute den Dom als ein Monument der Macht der Papstkirche. Von der phantastischen Kraft der sich vom feudalen und kirchlichen Druck befreienden Volkselemente[n] ist hier keine Spur.“
Für unlautere Zwecke umgebogene Spitzbogigkeit – da hat der neue Mensch sich der Gefahr eigener Biegsamkeit intellektuell-spitz und notfalls revolutionär-bockig zu erwehren. Vogelers idealistisches Menschenbild von der in klassenloser Gesellschaft möglichen „gegenseitigen Hilfe“, kristallisch-drusenhaft und christlich-nächstenliebend seit der Barkenhoff-Kommune 1918ff erdacht, gibt sich sogar im Angesicht einer Diktatur genau in solch hehrem Namen nicht geschlagen. Im mitgeführten Koffer fand man nach seinem bitteren Tod etliche Zeichnungen und Schriftstücke, die bezeugen, dass Vogeler von den ererbten und angeeigneten Formen mittelalterlich-frühneuzeitlicher Porträtmalerei und eben den großen Gedanken der europäischen Gotik noch in kasachischer Verlorenheit gezehrt hat.
Heinrich Vogeler lässt an Heinrich den Vogler denken
Den Bogen wollen wir nicht überspannen. Aber die Wiederbelebung des gotischen Mittelalters durch Formen sozialistisch-sowjetrussischen Furors ausgerechnet in Verbindung mit einem Namen, der so sehr an den ersten deutschen König erinnert, gibt doch zu denken. Wenn etwas zu Ende geht, werden die Alten bemüht: Die Männer aus oldenburgischem Fürstengeschlecht heißen heutzutage so wie ihre gräflichen Vorfahren, deren Linie bereits im Jahre 1667 ausstarb: Anton Günther, Christian oder Huno. Der letzte, im Jahre 476 abgesetzte und in Pension geschickte weströmische Kaiser wurde Romulus Augustulus genannt, den mythischen Gründer der Stadt Rom und den Begründer des Imperiums gleichermaßen aufrufend. Und so gemahnt vielleicht der in der Gründerzeit geborene Heinrich Vogeler an jenen ersten Heinrich, der in entschieden vorgotischer Zeit „am Vogelherd“ von einer Delegation wackerer Edelmänner zum Regenten ausersehen wurde. Die bekannte Ballade von Johann Nepomuk Vogl (!!!), durch Carl Loewe vertont, weiß davon ein Lied zu singen.
Mit dem Urenkel des ersten Heinrich beginnt die Glanzzeit der Kaiserpfalz zu Goslar. Heinrich der Zweite, der Dritte und der Vierte haben die „Schatzkammer des Reiches“ oft besucht und durch die Anwesenheit ihres jeweiligen Hofstaates nicht nur die Bergbauindustrie befördert, sondern auch der Stadt und ihren Einwohnern zu starkem Selbstbewusstsein verholfen. Mit dem Kaiserhaus entstand dort der seinerzeit größte Profanbau nördlich der Alpen, und seine romanische Architektur nahm man in den sechziger Jahren des neunzehnten Jahrhunderts zum Anlass, wenigstens diesen Palast, die Ulrichskapelle und die den Kaiserstuhl beherbergende Vorhalle der vierzig Jahre zuvor wegen hoffnungsloser Baufälligkeit abgerissenen Stiftskirche mehr oder weniger mustergültig zu rekonstruieren und im Inneren zeitgenössisch auszugestalten. Der preußische Staat als Nachfolger des Königreichs Hannover hat hier damals Maßstäbe für die Zukunft gesetzt.

Es gibt also keinen Grund zum Benörgeln deutscher Tradition. Solange wir romanische Bauten stolz den Touristen herzeigen und die nachfolgenden gotischen Bauwerke ideell verinnerlicht haben; solange wir die Hochsprache der Lutherbibel sprechen und doch noch irgendeinen Schimmer von Weimarer Klassik und phantastischer Romantik uns bewahren; und solange wir uns im klaren darüber sind, dass unsere moderne industrialisierte arbeitsteilige Gesellschaft nur so sich gut weiterentwickeln kann, wenn wir uns von den Kräften der Geschichte leiten lassen – dann müssen wir nicht in Furcht erstarren vor den Abirrungen gestern und heute, sondern können ganz getrost unsere alten Tagebücher und Bilder hervorholen: nicht, um an ihnen herumzukritteln, erst recht nicht, um sie zu verdammen; – sondern: um in ihnen die Grundlage unserer gewiesenen Wege zu erkennen. Dann sind wir im Leben stark. Und nicht nur manchmal.
Fotos: Gewölbe der frühgotischen Annenkapelle im Kreuzgang des Hildesheimer Domes; Seiteneingang der neugotischen Außenhülle von St. Lamberti Oldenburg; Blick in den Garten des Barkenhoffs in Worpswede; Kaiserstuhl in Goslar im Spiegel des Alltags.